Franziska zu Reventlow: Die Freiheitsliebende
Bis heute ist Franziska zu Reventlow eine Legende, die untrennbar mit den schillernden Zeiten des Münchner Stadtteils Schwabing verbunden ist. Zu wenig Beachtung finden im Vergleich dazu ihr literarisches Werk und die vielen Literaturübersetzungen, die sie um 1900 anfertigte.


Steckbrief
- Name
- Franziska zu Reventlow
- Geboren
- 1871 in Husum
- Gestorben
- 1918 in Locarno
- Wichtige Stationen
-
Zeitraum Tätigkeit 1890–1892: Besuch eines Lehrerinnenseminars in Lübeck 1895–1910: Umzug nach München, Veröffentlichung von Zeitungsartikeln und Erzählungen 1910–1918: Ansiedlung am Lago Maggiore in der Schweiz, Entstehen der „Schwabinger Romane“ - Zeitalter
- Jahrhundertwende
- Wirkungsfeld
- Literatur
- Frauenort
-
München
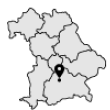
Ein Leben jenseits der Zwänge
Über gesellschaftliche Normen und Vorstellungen setzte sich Franziska Gräfin zu Reventlow ihr Leben lang hinweg. Schon als junge Frau trotzte die Tochter eines preußischen Landarztes ihren Eltern den Besuch eines Lehrerinnenseminars ab. Ein Dasein als sittsame Lehrerin allerdings hatte sie nie im Sinn. Das Seminar bot ihr und anderen Frauen zu dieser Zeit lediglich die einzige Möglichkeit, eine gehobene Bildung zu erwerben.
Schon damals sorgten ihre Liebschaften für Skandale. Ungewollt schwanger, heiratete sie einen Hamburger Gerichtsbeamten. Der ermöglicht ihr nach einer Fehlgeburt zwei München-Aufenthalte, um eine Malschule zu besuchen. München, und vor allem der Stadtteil Schwabing, war um 1890 ein schillernder Anziehungspunkt für Künstler aus ganz Europa. Franziska zu Reventlow tauchte tief in diese Welt ein. Und sie erlaubte sich für diese Zeit im Umgang mit Männern unerhörte Freiheiten. 1896 wurde sie wegen fortgesetzten Ehebruchs geschieden.
„…ich will überhaupt lauter Unmögliches, aber lieber will ich das wollen, als mich im Möglichen schön zurechtzulegen.“
Franziska zu Reventlow, Tagebucheintrag 1903
Übersetzungen und Romane
Etwa zur gleichen Zeit begann Franziska zu Reventlow, in verschiedenen Zeitschriften Texte zu veröffentlichen. 1897 kam ihr Sohn Rolf zur Welt. Den Namen seines Vaters verriet sie niemandem. Stattdessen versuchte sie, sich und ihr Kind alleine durchzubringen. Geld verdiente sie vor allem mit Übersetzungen: Zwischen 1898 und 1910 übertrug sie mehr als 40 Werke der zeitgenössischen französischen Literatur ins Deutsche. Diese enorme Leistung wird bis heute zu wenig gewürdigt.
Mehr Beachtung fanden von Anfang an ihre Romane und Erzählungen. Die meisten Bücher, die das Leben in Schwabing beschreiben – „Herrn Dames Aufzeichnungen“ oder „Der Geldkomplex“ – erschienen allerdings erst, als sie bereits in der Schweiz lebte: 1910 war Franziska zu Reventlow in Ascona eine Scheinehe eingegangen, um ihre andauernden finanziellen Probleme zu lösen. Acht Jahre später starb sie an den Folgen eines Fahrradunfalls. Ihre Jahre in Schwabing aber machten sie zu einer bis heute unsterblichen Legende.
„Ich will und muss einmal frei werden; es liegt nun einmal tief in meiner Natur, dieses maßlose Streben, Sehnen nach Freiheit.“
Franziska zu Reventlow in einem Brief 1890
Quellen- und Literaturhinweise
Teibler, Claudia: Die bayerischen Suffragetten. München, 2022, S. 116 – 119
Briatte, Anne-Laure: Literaturübersetzerinnen im deutschen literarischen Feld um 1900. In: Bland, Caroline, Müller-Adams, Elisa (Hrsg.): Frauen in der literarischen Öffentlichkeit 1780-1918. Bielefeld, 2007
Sperr, Franziska: Die kleinste Fessel drückt mich unerträglich. Das Leben der Franziska zu Reventlow. München, 2003

