Gerty Spies: Die Versöhnliche
Im Konzentrationslager Theresienstadt wurde Gerty Spies zur Schriftstellerin: Das Schreiben von Gedichten half ihr, das Grauen zu überleben. Später setzte sie sich für die Verständigung von Deutschen und Juden ein. Ihr literarisches Werk aber wurde erst in den 1980er Jahren wirklich entdeckt.

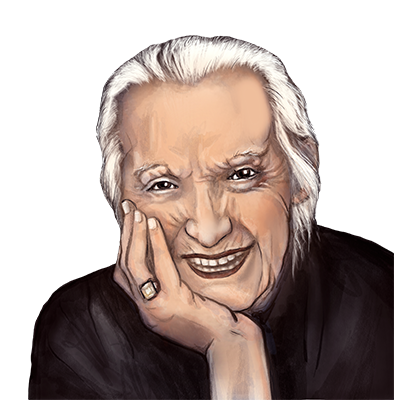
Steckbrief
- Name
- Gerty Spies
- Geboren
- 1897 in Trier
- Gestorben
- 1997 in München
- Wichtige Stationen
-
Zeitraum Tätigkeit 1920–1929: Heirat mit dem Chemiker Alfred Spies, Geburt zweier Kinder, Scheidung, Umzug nach München 1939–1947: Zwangsarbeit, Haft im Konzentrationslager Theresienstadt, Beginn des literarischen Schreibens 1984–1997: Literarische Wiederentdeckung des Werks von Gerty Spies - Zeitalter
- NS-Zeit
- Wirkungsfeld
- Literatur
- Frauenort
-
München
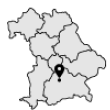
Lichtblicke selbst in dunkelster Zeit
Gerty Spies war noch in finstersten Situationen – etwa während ihres Transports ins Konzentrationslager Theresienstadt – in der Lage, die Schönheit von Blumen oder Landschaft wahrzunehmen. Sie verschloss vor menschlichen Abgründen nie die Augen, vermochte es aber dennoch, sich versöhnliche Gedanken zu bewahren. Der einzigartige Geist dieser in Trier geborenen Schriftstellerin offenbarte sich gerade in Deutschlands dunkelsten Jahren und den Jahrzehnten, die auf die nationalsozialistische Herrschaft folgten.
1927 zog die ausgebildete Kindergärtnerin nach München-Schwabing. Gerade hatte sie sich scheiden lassen und beschlossen, ihre sechsjährige Tochter alleine großzuziehen. Ihren Lebensunterhalt bestritt sie unter anderem mit dem Verfassen launiger Zeitungsartikel.
Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde das Leben für die Jüdin Gerty Spies schwierig: Nach Demütigungen und immer stärker eingeschränkten beruflichen Möglichkeiten musste sie ab 1939 Zwangsarbeit in einem Münchner Verlag leisten.
„Ich kann das Land nicht hassen, wo ich so viel geliebt, gelacht, gebetet habe. Ich kann auch das Volk nicht hassen – trotz allem.“
Gerty Spies, aus dem Roman „Bittere Jugend“
Lebenslanger Einsatz für Verständigung
1942 wurde sie mit vielen anderen Münchner Juden im Konzentrationslager Theresienstadt inhaftiert. Es gelang ihr, zu überleben, auch deshalb, weil sie begann, ihre Beobachtungen und Empfindungen in geradlinigen Gedichten festzuhalten. Als Schreibmaterial dienten ein Bleistiftstummel und Packpapier, das sie heimlich an sich nahm.
Nach ihrer Befreiung kehrte sie nach München zurück. 1947 veröffentlichte sie ihre Gedichte in dem Band „Theresienstadt“. Für ihre Erinnerungssammlung „Drei Jahre Theresienstadt“ und ihren Roman „Bittere Jugend“ jedoch fand sie in der Bundesrepublik der 1950er Jahre keinen Verlag mehr.
Verbittern ließ sich die erstaunliche Schriftstellerin jedoch nie. Zeit ihres Lebens setzte sie sich für Verständigung und Versöhnung ein. 1984 wurde sie Ehrenvorsitzende der Münchner Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit. In den Folgejahren erschienen auch ihre Theresienstadt-Erinnerungen, ihr Roman sowie weitere Erzählungen und Gedichte.
„Mein Heimweh zu dieser Stadt (…) war so stark in mir, dass das andere (…) mir gleichgültig geworden war (…). Es war nicht die Hauptsache.“
Gerty Spies über die Gründe, warum sie nach dem Ende des NS-Regimes nach München zurückkehrte
Quellen- und Literaturhinweise
Salamander, Rachel: „Es hat etwas Versöhnendes“. Das Schreiben der Gerty Spies. In: Ludwigs-Maximilians-Universität (Hrsg.): Münchner Beiträge zur jüdischen Geschichte und Kultur, 1, 2008, S. 49 – 72
Vollhardt, Ulla-Britta: Gerty Spies, veröffentlicht am 16. Januar 2025, abgerufen am 23. Mai 2025

