Maria Luiko: Die Verschollene
Die jüdische Künstlerin Maria Luiko stand am Anfang einer vielversprechenden Karriere, als die Nationalsozialisten die Macht übernahmen. Ab 1933 konnte sie ihre Bilder praktisch nicht mehr ausstellen. Aber sie schuf Marionetten, deren Ausdruckskraft bis heute jeden Betrachter berührt.


Steckbrief
- Name
- Maria Luiko
- Geboren
- 1904 in München
- Gestorben
- 1941 in Kaunas
- Wichtige Stationen
-
Zeitraum Tätigkeit 1923–1927: Studium der Malerei und Graphik an der Akademie der Bildenen Künste, München 1924–1931: Jährliche Teilnahme an Ausstellungen im Münchner Glaspalast 1934–1937: Gründung des Marionettentheaters Jüdischer Künstler, Gestaltung von Puppen und Bühnenbildern - Zeitalter
- NS-Zeit
- Wirkungsfeld
- Bildende Kunst, Musik und Theater
- Frauenort
-
München
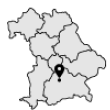
Eine vielseitig begabte Künstlerin
Als „verschollene Generation“ werden heute Künstler bezeichnet, die etwa zur gleichen Zeit wie Maria Luiko geboren wurden und als Juden in Deutschland lebten. Denn sie mussten, kaum dass ihre Karriere begonnen hatte, ihre künstlerische Arbeit wieder einstellen. Entweder gelang es ihnen nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, Deutschland zu verlassen. Oder sie wurden vom Regime ermordet.
Dieses Schicksal teilte auch Maria Luiko. Schon während ihrer Ausbildung zur Kindergärtnerin, die sie 1922 abschloss, nahm sie Mal- und Zeichenunterricht. 1923 begann sie ihr Studium an der Akademie der Bildenden Künste.
Anschließend besuchte sie die Theaterklasse der Kunstgewerbeschule und lernte, Bühnenbilder und Kostüme zu gestalten. Parallel nahm sie an den jährlichen Kunstausstellungen im seinerzeit berühmten Münchner Glaspalast teil. Sie war so vielseitig begabt, dass sie das Publikum jedes Jahr mit Arbeiten in einer anderen Technik überraschte.
„So ausgemachten süßlichen Kitsch, wie die es wollen, kann ich leider nicht.“
Maria Luiko über eine Bildanfrage, die sie 1935 trotz ihrer angespannten wirtschaftlichen Situation ablehnte
Theater in schwierigen Zeiten
Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 wurde das Leben für jüdische Künstler äußert schwierig: Unter anderem durften sie ihre Werke nicht mehr ausstellen.
Maria Luiko ließ sich nicht unterkriegen. Um Geld zu verdienen, lernte sie, Metall zu bearbeiten und fertigte Gefäße und Aschenbecher an. Und sie gründete mit Opernsängern und Schauspielern das „Münchner Marionettentheater Jüdischer Künstler“. Fünf Sprechtheater-Stücke und drei Einakter mit Musik brachte die Gruppe auf die Bühne.
Ab 1938 wurden die Juden in Deutschland so vieler Rechte beraubt, dass auch diese Theateraufführungen nicht mehr möglich waren. Im November 1941 wurde die Künstlerin nach Litauen deportiert und ermordet.
Wie ausdrucksstark ihre Kunst war, wird heute nicht nur anhand erhaltener Bilder und Grafiken greifbar. Das Münchner Stadtmuseum besitzt zudem 49 ihrer Marionetten. Sie vermitteln auch 90 Jahre nach ihrem Entstehen einen lebendigen Eindruck vom Einfühlungsvermögen und der gestalterischen Kraft, über die Maria Luiko verfügte.
„Maria Luiko, diese überaus sensible junge Frau mit verträumten, großen, schwarzen Augen, schuf in Holzschnitt und Lithographie und Ölbildern die Vision einer sternverdunkelten Welt.“
Der in München geborene Journalist Shalom Ben-Chorin in seiner Autobiografie „Jugend an der Isar“
Quellen- und Literaturhinweise
Diana Oesterle: „So süßlichen Kitsch, das kann ich nicht“ – Die Münchner Künstlerin Maria Luiko (1904 – 1941), München, 2009
Gedenkalbum: Die jüdische Künstlerin Maria Luiko (1904 – 1941), abgerufen am 4.12.2024

