Liutpirc: Die Übersehene
Sie war selbst Königstochter und gab wohl den entscheidenden Anstoß für die Gründung des Klosters Frauenchiemsee. Dennoch wurde Liutpirc, die Ehefrau von Bayern-Herzog Tassilo III., jahrhundertelang praktisch übersehen. Erst langsam entdecken Geschichtswissenschaftler ihre Bedeutung.


Steckbrief
- Name
- Liutpirc, Herzogin von Bayern
- Geboren
- Vor 750 in Unbekannt
- Gestorben
- Nach 780 in Unbekannt
- Wichtige Stationen
-
Zeitraum Tätigkeit Wohl 763: Hochzeit mit Bayern-Herzog Tassilo III. 782: Gründung des Klosters Frauenchiemsee 788: Verbannung, möglicherweise ins Kloster Corbie - Zeitalter
- Früh- und Hochmittelalter
- Wirkungsfeld
- Politik und Medien
- Frauenort
-
Frauenchiemsee
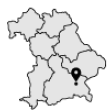
Auf Augenhöhe mit dem Herzog
Welche Bedeutung eine Frau im frühen Mittelalter hatte oder wie viel Macht sie besaß, ist meist nirgendwo aufgeschrieben. Geschichtswissenschaftler können das größtenteils aus Kunstgegenständen aus dieser Zeit ableiten, die erhalten geblieben sind. Doch auch darauf wurden Frauennamen häufig übersehen. Liutpirc, die immerhin etwa 25 Jahre Herzogin von Bayern war, wurde jahrhundertelang nicht wirklich wahrgenommen.
Dabei war Liutpirc die Tochter des Königs der Langobarden, eines in Italien ansässigen Volksstamms. Bayernherzog Tassilo III. heiratete sie aus politischen Gründen, fand in ihr aber auch eine kluge und gut vernetzte Partnerin. Die heutige Sichtweise auf die geschichtlichen Quellen legt nahe, dass sie auf Augenhöhe mit Tassilo auftrat und handelte.
Anstoß für eine Klostergründung
Beispielsweise ist auf einem Kelch, den das Herzogspaar für das in Österreich gelegene Stift Kremsmünster stiftete, Liutpircs Name ebenso genannt wie der Name Tassilos. Dennoch hieß der Kelch über Jahrhunderte „Tassilo-Kelch“ und wurde erst vor wenigen Jahren in „Tassilo-Liutpirc-Kelch“ umbenannt. Auch bei der Gründung des Klosters Frauenchiemsee, für das lange Tassilo als Stifter galt, vermuten Wissenschaftler inzwischen, dass der Anstoß dafür von Liutpirc ausging.
Liutpirc und Tassilo hatten vier Kinder, zwei Söhne und zwei Töchter. Doch sie konnten ihre Macht und Stellung nicht dauerhaft an sie weitergeben. Der König Karl der Große entmachtete Tassilo 788 und verbannte seine Familie in verschiedene Klöster. Ab diesem Zeitpunkt verliert sich Liutpircs Spur.
Quellen- und Literaturhinweise
Hartmann, Martina: Liutpirc und ihre Töchter. In: Wamers, Egon (Hrsg.): Der Tassilo-Liutpirc-Kelch im Stift Kremsmünster. Regensburg, 2019
Prochno, Renate: Der Tasilokelch. Anmerkungen zur Forschungsgeschichte. In: Kolmer, Lothar u.a. (Hrsg.): Tassilo III. von Bayern. Regensburg, 2005
Wamers, Egon: Tassilo-Liutpirc-Kelch. Veröffentlicht am 30.10.2020, abgerufen am 14.12.2024
Wamers, Egon: Tassilo, Liutpirc und die Schatzkunst am Hof der Agilolfinger. In: Paulus, Christof u.a. (Hrsg.): Tassilo, Korbinian und der Bär. Katalog zur Bayerischen Landesausstellung 2024. Augsburg, 2024. S. 90-109
Handle-Schubert, Elisabeth u.a.: Tassilo – Herzog oder König. In: Paulus, Christof u.a. (Hrsg.): Tassilo, Korbinian und der Bär. Katalog zur Bayerischen Landesausstellung 2024. Augsburg, 2024. S. 208-241

