Lola Kronheimer-Sinz: Die Wandlungsfähige
Vor Lola Kronheimer-Sinz lag eine glänzende Karriere als Pianistin. Dann aber wurde sie von den Nationalsozialisten verfolgt, weil sie Jüdin war. Es gelang ihr, unter falschem Namen ins Allgäu zu fliehen. Dort begann sie ein komplett neues Leben als Landwirtin.


Steckbrief
- Name
- Lola Kronheimer-Sinz
- Geboren
- 1910 in München
- Gestorben
- 1993 in Sonthofen
- Wichtige Stationen
-
Zeitraum Tätigkeit 1928–1931: Studium an der Hochschule für Musik in München, erste Erfolge als Konzertpianistin 1933: Ausschluss aus der Reichsmusikkammer, weil ihr Vater Jude war 1945: Flucht nach Beilenberg, später Familiengründung und Tätigkeit in der Landwirtschaft - Zeitalter
- NS-Zeit
- Wirkungsfeld
- Landwirtschaft, Musik und Theater
- Frauenort
-
Beilenberg bei Bad Hindelang
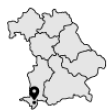
Von der Pianistin zur Verfolgten
Als Lola Kronheimer-Sinz 1931 ihr Studium an der Münchner Musikhochschule abschloss, stand sie vor einer großen Karriere als Pianistin. Die Uraufführung eines Werks für zwei Klaviere, die sie mit einer Studienfreundin bestritt, war umjubelt. Konzerte und Radiosendungen standen in Aussicht.
1933 waren davon nur noch Trümmer übrig. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde Lola Kronheimer-Sinz aus der Reichsmusikkammer ausgeschlossen. Denn ihr Vater war Jude. Nun durfte sie nur noch auf Veranstaltungen des „Jüdischen Kulturbunds“ auftreten.
1935, mit Erlass der „Nürnberger Rassengesetze“, erlosch auch diese Möglichkeit. Juden wurde jegliche Teilhabe am öffentlichen Leben untersagt. Ab 1941 musste Lola Kronheimer-Sinz in einer Hutfabrik Zwangsarbeit leisten – ein Umstand, der ihr letztlich das Leben rettete: Als sie sich Anfang 1945 zum Transport in ein Konzentrationslager einfinden sollte, sorgte der Fabrikdirektor dafür, dass sie unter falschem Namen ins Allgäu reisen konnte.
„Nach den ,Nürnberger Gesetzen‘ wurde ich 1935 als sogenannte ,Geltungsjüdin‘ eingestuft. Das war das endgültige Aus – für meinen Beruf, für meine Liebe, fast für mein ganzes Leben. Die Lola Kronheimer gab es auf einmal nicht mehr.“
Lola Kronheimer-Sinz rückblickend über ihre zunehmende Entrechtung in der NS-Zeit
Ein neues Leben im Allgäu
In einem Bauernhof in Beilenberg konnte sie sich verstecken, bis der Krieg zu Ende war. Danach kehrte sie zunächst nach München zurück. Doch sie erkannte rasch, dass es in der vom Krieg zerstörten Stadt keine Perspektive für sie gab. Also fuhr sie wieder nach Beilenberg und heiratete den Landwirt Andreas Sinz. Das Paar nahm drei Adoptivkinder auf und gründete eine kleine Gastwirtschaft.
Erst als Andreas Sinz 1987 völlig überraschend starb, fand Lola Kronheimer-Sinz die Zeit, sich wieder mit ihren eigenen Interessen zu beschäftigen. Sie blieb zwar im Allgäu wohnen. Aber sie fuhr oft nach München, um Konzerte zu hören und Musikerinnen und Musiker zu treffen, die sie noch aus der Vorkriegszeit kannte.
Im Umgang mit den Geschehnissen im Dritten Reich war ihr vor allem Versöhnung wichtig. Als die Täter und Mitläufer des Regimes zur Rechenschaft gezogen wurden, sagte sie für alle aus, die ihr in diesen Jahren geholfen hatten. Noch Jahrzehnte später betonte sie, dass für sie in deren Hilfsbereitschaft der eigentliche Charakter Deutschlands lag.
„Die Nationalsozialisten haben aus Deutschland etwas gemacht, was nicht sein wahres Gesicht ist. Sein wahres Gesicht musste es verstecken.“
Lola Kronheimer-Sinz in einem Zeitzeugeninterview des Hauses für Bayerische Geschichte
Quellen- und Literaturhinweise
Zeitzeugeninterview des Hauses der Bayerischen Geschichte mit Lola Sinz, abgerufen am 25.02.2025
Kronheimer-Sinz, Lola: Erinnerungen einer Münchner Pianistin. In: Landeshauptstadt München (Hrsg.): Frauenleben in München. Lesebuch zur Geschichte des Münchner Alltags. München, 1993, S. 121 - 124

