Maria Catharina Stockfleth: Die Gleichberechtigte
In einer Zeit, in der Frauen mit ihren Fähigkeiten und Talenten kaum wahrgenommen wurden, tat Maria Catharina Stockfleth etwas Einzigartiges: Sie führte eine Ehe auf Augenhöhe, erwarb sich einen Ruf als Dichterin und verfasste einen Roman, in dem alle Menschen gleich sind.


Steckbrief
- Name
- Maria Catharina Stockfleth
- Geboren
- 1634 in Nürnberg
- Gestorben
- 1692 in Münchberg
- Wichtige Stationen
-
Zeitraum Tätigkeit 1653–1665: Ehe mit dem Hilpolststeiner Hofprediger Johann Conrad Heden ab 1668: Mitglied im „Pegnesischen Blumenorden“, Ernennung zur „gekrönten Dichterin“ 1669: Heirat mit dem Theologen Heinrich Arnold Stockfleth, Abfassen des Schäferromans „Die kunst- und tugendgezierte Macarie“ - Zeitalter
- Barock
- Wirkungsfeld
- Literatur
- Frauenort
-
Irrhain / Kraftshof bei Nürnberg
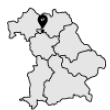
Leben und Dichten auf Augenhöhe
Eine Welt, in der alle gleich sind – Könige und Schäfer, Männer und Frauen: In der harten Wirklichkeit des 17. Jahrhunderts war so etwas völlig undenkbar. Die Dichterin Maria Catharina Stockfleth schrieb dennoch eine solche Vision nieder: im zweiten Teil des Romans „Die kunst- und tugendgezierte Macarie“. Diesen verfasste sie zwischen 1669 und 1673 gemeinsam mit ihrem Mann, dem Theologen Heinrich Arnold Stockfleth.
Doch nicht nur in diesem Roman, auch in ihrer Ehe und innerhalb der literarischen Gruppe, in deren Rahmen die „Macarie“ entstand, wurde dieses Ideal ein Stück weit Wirklichkeit. Denn als die Hochzeit von Maria Catharina und Heinrich Arnold Stockfleth 1669 stattfand, war die 35-jährige Theologentochter bereits einmal verheiratet gewesen. Und sie war weithin für ihre Dichtkunst berühmt. Ihr neun Jahre jüngerer Mann dagegen stand darin noch völlig am Anfang.
„Man sagt zwar sonst: Wer viel von Träumen hält / Verwickelt sich mit Lügen / Und muss sich selbst betrügen. Doch / warnt auch oft ein Traum / Eh uns das Unglück trifft. Nicht alle Träum verführen.“
Aus einem Gedicht von Maria Catharina Stockfleth
Wiederentdeckung im 20. Jahrhundert
Daher war es auch Maria Catharina Stockfleth, die beim gemeinsamen Abfassen des Romans den Ton angab. Dessen zweiten, literarisch bedeutenderen Teil, schrieb sie, wie die Forschung inzwischen nachgewiesen hat, sogar allein.
Und die Dichtervereinigung, der „Pegnesische Blumenorden“, der Maria Catharina Stockfleth und ihr Mann angehörten, legte auf die gleichberechtigte Teilnahme von Frauen ausdrücklich Wert. Darin unterschied er sich von vielen vergleichbaren Gesellschaften dieser Zeit.
Auch später, als ihr Mann in der Kirche Karriere machte, behielt Maria Catharina Stockfleth das Schreiben bei. Von den Werken dieser Zeit ist allerdings kaum etwas überliefert. Auch der „Macarie“-Roman wurde erst 1934 wiederentdeckt. Die literarische Forschung des 20. Jahrhunderts erkannte Stockfleths große Bedeutung: Als Dichterin reizte sie die literarischen Möglichkeiten ihrer Zeit für ihre modernen Visionen bis an die Grenzen aus.
Quellen- und Literaturhinweise
Brandes, Ute: Studierstube, Dichterklub, Hofgesellschaft: Kreativität und kultureller Rahmen weiblicher Erzählkunst im Barock. In: Brinker-Gabler, Gisela (Hrsg.): Deutsche Literatur von Frauen. Bd. 1: Vom Mittelalter bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. München, 1988. S. 222 - 247
Wiebe, Christian, Karabulut, Zozan (Hrsg.): ,So kein Mund aussprechen kann‘. Barocklyrik von Frauen. Hannover, 2021

