May Ayim: Die Kämpferin gegen Rassismus
Sie war die Tochter eines Ghanaers. Doch als adoptiertes Kind wuchs May Ayim in einer ausschließlich weißen Familie auf. Die vielen Arten, mit denen Menschen und Minderheiten bewusst oder unbewusst ausgegrenzt werden, wurden für sie zum Lebensthema.


Steckbrief
- Name
- May Ayim
- Geboren
- 1960 in Hamburg
- Gestorben
- 1996 in Berlin
- Wichtige Stationen
-
Zeitraum Tätigkeit 1979: Abitur in Münster bis 1986: Pädagogik- und Psychologie-Studium in Regensburg, erste Afrikareisen ab 1987: Ausbildung zur Logopädin, Lehraufträge an diversen Berliner Hochschulen - Zeitalter
- Ab 1980er Jahre
- Wirkungsfeld
- Bildung und Erziehung, Politik und Medien
- Frauenort
-
Regensburg
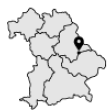
Gegen die eigene Ausgrenzung
May Ayims Engagement gegen Rassismus begann mit der Suche nach ihrer eigenen Identität. Geboren als Tochter eines Ghanaers und einer Hamburgerin lebte sie zunächst in einem Heim und wurde dann von einer Familie aus Münster adoptiert. Als einziges Schwarzes Kind wuchs sie in einer völlig „weißen“ Umgebung auf. Rasch merkte sie, dass es die Reaktionen auf ihr Äußeres waren, die ihr das Gefühl gaben, anders zu sein als alle anderen.
Erst als junge Frau stellte sie fest, dass sie mit dieser Erfahrung keineswegs alleine war, sondern dass es vielen anderen Schwarzen Menschen und People of Color in Deutschland ebenso erging. Diese Erkenntnis war für sie so einschneidend, dass sie Fragen nach dem Miteinander von Schwarz und Weiß zum Zentrum ihres Lebens machte. Ein Lehramtsstudium, das sie nach dem Abitur in Münster begonnen hatte, brach sie ab. Stattdessen ging sie nach Regensburg, um Psychologie und Pädagogik zu studieren.
„nachdem sie mich erst anschwärzten zogen sie mich dann durch den kakao um mir schließlich weiß machen zu wollen es sei vollkommen unangebracht – schwarz zu sehen.“
May Ayim, „exotik“ (1985)
Vorurteile in der Sprache
Die Jahre, die sie in der Stadt an der Donau verbrachte, waren für ihren Prozess, sich selbst und die eigenen Wurzeln zu finden, entscheidend. In dieser Zeit reiste sie auch nach Ghana, in die Heimat ihres Vaters, und lernte ihre Großfamilie kennen.
Später zog sie nach Westberlin und machte eine Ausbildung zur Logopädin. Während dieser Ausbildung durchleuchtete sie den Rassismus, der sich in der deutschen Sprache verbirgt. In weiteren wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigte sie sich mit Fragestellungen zu Rassismus und Sexismus. Hierzu nahm sie auch Lehraufträge an diversen Universitäten an. Gleichzeitig begann sie, Gedichte zu veröffentlichen und auf internationalen Konferenzen aufzutreten, die ebenfalls Rassismus zum Thema hatten. Ihren deutschen Namen legte sie ab und nahm stattdessen den Namen ihres Vaters an.
1996 setzte sie nach einer psychischen Krise ihrem Leben selbst ein Ende. Die Bedeutung, die sie für die afrodeutsche Bewegung spielte und spielt, ist bis heute ungebrochen.
„Es hat lange gebraucht, bis mir bewusst wurde, dass ich aus mir selbst heraus einen Wert habe. In dem Moment, als ich zu mir ,ja‘ sagen konnte, ohne den geheimen Wunsch nach Verwandlung, war die Möglichkeit gegeben, die Brüche in mir und meiner Umgebung zu erkennen … und aus ihnen zu lernen.“
May Ayim, in „Grenzenlos und unverschämt“, 1997
Quellen- und Literaturhinweise
Kelly, Natasha A.: May Ayim, in: Digitales Deutsches Frauenarchiv, abgerufen am 21.12.2024
Ayim, May: Grenzenlos und unverschämt. Berlin, 1997

