Sophie Scholl: Die Unerschrockene
Sophie Scholl war erst 21 Jahre alt, als sie als Mitglied der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ von den Nationalsozialisten hingerichtet wurde. Ihre Entschlossenheit und ihr Mut beeindrucken bis heute.


Steckbrief
- Name
- Sophie Scholl
- Geboren
- 1921 in Forchtenberg/Württemberg
- Gestorben
- 1943 in München
- Wichtige Stationen
-
Zeitraum Tätigkeit 1940–1942: Beginn einer Ausbildung zur Kindergärtnerin, Arbeits- und Kriegshilfsdienst 1942–1943: Biologie- und Philosophiestudium in München, Mitglied der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ 1943: Verhaftung am 18. Februar, Verurteilung und Hinrichtung am 22. Februar - Zeitalter
- NS-Zeit
- Wirkungsfeld
- Politik und Medien
- Frauenort
-
München
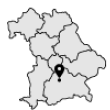
Eine junge Frau bleibt aufrecht
Das Bild herabwirbelnden Papiers im Lichthof der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität: Heute gilt es als Sinnbild für den zivilen Widerstand gegen das menschenverachtende Regime der Nationalsozialisten. Am 18. Februar 1943 verteilte Sophie Scholl mit ihrem Bruder Hans heimlich Flugblätter. Dabei gab sie einem auf einer Brüstung platzierten Stapel einen Schubs. Die fliegenden Blätter erregten bei den Studenten, die gerade aus ihren Vorlesungen kamen, Aufmerksamkeit. Sie führten aber auch zur Festnahme der Geschwister und weiterer Mitglieder der studentischen Widerstandsgruppe „Weiße Rose“. Nur vier Tage später wurden Sophie und Hans Scholl mit ihrem Mitstreiter Christoph Probst zum Tode verurteilt und hingerichtet.
„Was liegt an meinem Tod, wenn durch unser Handeln tausende von Menschen aufgerüttelt und geweckt werden.“
Sophie Scholl in den Tagen vor ihrer Hinrichtung, zitiert nach ihrer Zellengenossin Else Gebel.
Von einer Anhängerin zur überzeugten Gegnerin
Zunächst war Sophie Scholl von einigen Ideen des Nationalsozialismus angetan. Bald allerdings entdeckte sie, wie menschenverachtend diese Weltanschauung war. Erlebnisse während ihres Arbeits- und Kriegshilfsdiensts in den Jahren 1941/1942 bestärkten sie in ihrer Abkehr.
Im Mai 1942 schrieb sich Sophie Scholl an der Universität in München ein, wo ihr Bruder Hans seit drei Jahren Medizin studierte. Durch ihn kam sie in Kontakt zu der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“. Sie begann, sich aktiv am Druck und der Verbreitung von Flugblättern zu beteiligen. In welche Gefahr sie sich damit begab, war ihr ebenso bewusst wie den anderen Mitgliedern der Gruppe.
Sophie Scholls aufrechte Haltung in der Haft und während der Verhöre rückte in den letzten Jahrzehnten besonders ins Blickfeld. Die Erinnerung an ihren kompromisslosen Mut wird auch in Zukunft das Bewusstsein für Unrecht wachhalten und eine Mahnung daran sein, dass nie wieder eine Diktatur auf deutschem Boden entstehen darf.
„Das Gesetz ändert sich, das Gewissen nicht.“
Sophie Scholl während ihres Verhörs durch den Kriminalbeamten Robert Mohr
Quellen- und Literaturhinweise
Maren Gottschalk: Sophie Scholl. Wie schwer ein Menschenleben wiegt. München, 2020

